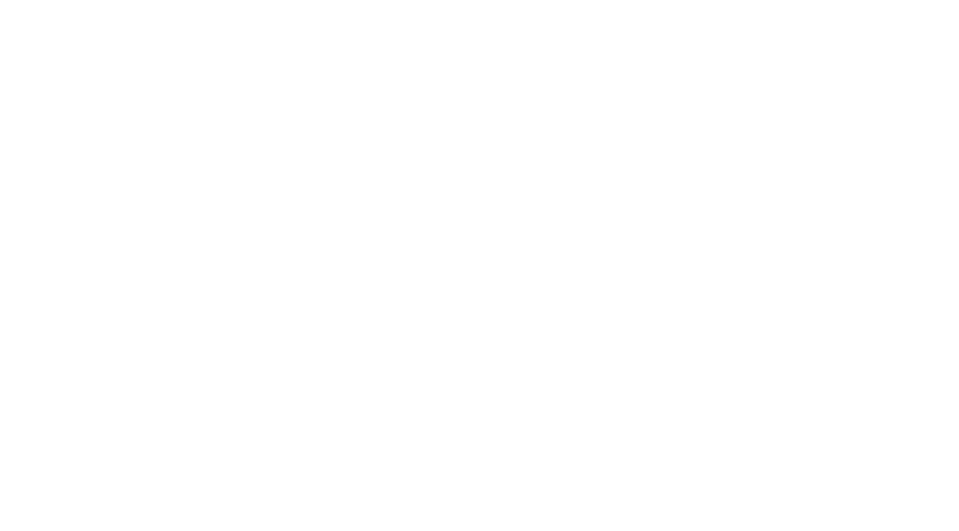„Demokratischer Volkswille und Wille zur Demokratie“ an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Bilder: Mert Rüttermann
Am 10. Juni 2025 widmeten sich die Teilnehmenden der Konferenz „Demokratischer Volkswille und Wille zur Demokratie" an der Universität Mainz den Fragen rund um Partizipation in der Demokratie aus interdisziplinärer Perspektive und in hybrider Form.
Was sind die rechtlichen Grundlagen für Bürgerräte und welche politikwissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir über das Engagement in Bürgerräten? Wie sieht die Arbeit von kommunalen Entwicklungsbeiräten aus, in denen Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammenkommen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln? Diesen Fragen gingen am Morgen Prof. Dr. Daniela Winkler von der Universität Stuttgart, Dr. Felix Petersen von der Universität Münster und Laura Gerards Iglesias von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) nach.
Am Nachmittag hielt Prof. Dr. Luisa Girnus von der Freien Universität Berlin einen politikwissenschaftlichen Vortrag zum Thema: Was verstehen wir unter Demokratiebildung? Es folgte dann ein Werkstattgespräch, in dem Marie Müller-Elmau vom Verfassungsblog die rechtlichen Grundlagen für Demokratiebildung in der Schule erläuterte und die politischen und rechtlichen Spielräume autoritär-populistischer Parteien aufzeigte, um Schulen zu instrumentalisieren. Peter Maaß gab Einblicke in die schulische Vermittlung von Demokratiebildung aus der Sicht eines hochmotivierten Gymnasiallehrers. Er zeigte anhand von zahlreichen Beispielen auf, wie schulisches und außerschulisches politisches Engagement im und außerhalb des Klassenraums gefördert werden kann. Zudem mahnte er an, dass Social Media das demokratische Bewusstsein verändere, Demokratiebildung müsse daher auch Medienbildung umfassen. Aus der Perspektive von Quentin Gärtner, neu gewählter Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, ist zum einen die Vermittlung von Demokratiebildung an vielen Schulen nicht mehr zeitgemäß. Zum anderen plädierte er dafür, die multiplen Krisen, denen junge Menschen heute ausgesetzt sind, mehr anzuerkennen. Man müsse unbedingt auch die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schüler stärken.
In einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Erbacher Hof/Mainz widmeten sich dann am Abend Prof. Dr. Friederike Wapler von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Dr. Samira Akbarian von der Goethe-Universität Frankfurt und Sabrina Kleinhenz von der Technischen Universität Darmstadt dem Thema Partizipation und Repräsentation von Kindern und Jugendlichen in unserer Demokratie. Moderiert hat Dr. Laura Anna Klein von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sabrina Kleinhenz, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Dachverbands der kommunalen Jugendvertretungen Rheinland-Pfalz, erklärte, wie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unserer Demokratie in Jugendvertretungen aussieht. Während die demografische Alterung in Deutschland weiter voranschreitet, gehört der Großteil der jungen Generation nicht zur wahlberechtigten Bevölkerung. Friederike Wapler zeigte deshalb auf, in welchem Verhältnis Repräsentation und Partizipation stehen. Die Professorin für Öffentliches Recht, die sich in ihrer Forschung den Rechten von jungen Menschen widmet, mahnte an, Kinder und Jugendliche stets ernst zu nehmen. Dazu zähle auch eine Absenkung des Wahlalters. Weil es nicht nur, aber oft junge Menschen sind, die Wälder besetzen oder Autobahnen blockieren und damit ihren Protest in unserer Gesellschaft ausdrücken, hat Samira Akbarian erklärt, wann und welche Formen zivilen Ungehorsams unserer Demokratie guttun. Es folgte eine lebhafte Diskussion mit dem Publikum.
Die Konferenz wurde gefördert aus dem Fonds Deutscher Studienpreis der Körber-Stiftung und von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.